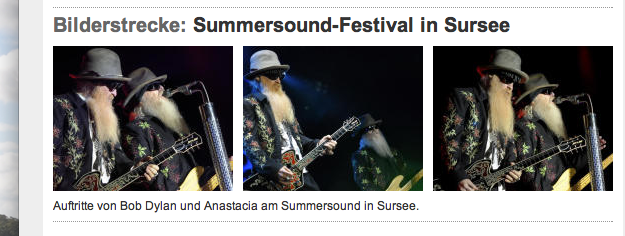
Der Bildlegenden-Texter der Neuen Luzerner Zeitung hätte wenigstens hinschreiben können, welcher der beiden Herren Anastacia ist.

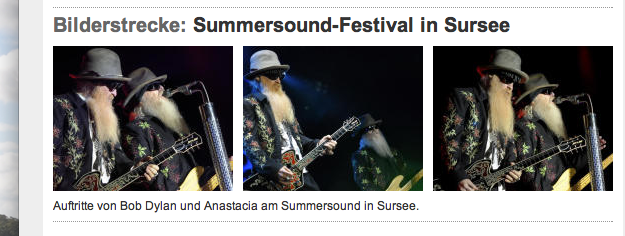
Der Bildlegenden-Texter der Neuen Luzerner Zeitung hätte wenigstens hinschreiben können, welcher der beiden Herren Anastacia ist.
Eigentlich wollte ich nur chli der Emme nach spazieren. Doch als ich am Fluss unten war, dachte ich: Auf den Flüeh wärs jetzt auch cheibe schön. Also wuchtete ich meine inzwischen noch 109 Kilo hoch auf die Sandsteinfelsen über Burgdorf:

Dort angekommen, fand ich, das könne es jetzt noch nicht gewesen sein.
Ich ging über Stock und Stein, an idyllischen Plätzchen vorbei

und an Chriesibäumen

und an Feldern, die keinen Anfang zu haben scheinen und kein Ende:

Irgendwann gab es dann buchstäblich kein Halten mehr: Wenn ich schon einmal hier war, wollte ich gleich ganz hinauf; auf 888 Meter über Meer.
Und so marschierte ich bei 30 Grad im Schatten – und damit bei meiner optimalen Betriebstemperatur – weiter, durch eine Landschaft, die nach Postkartenmotiven gestaltet worden sein muss:

 .
.
Stunden später war ich, um ziemlich sicher gut 50 Kilogramm leichter, genau da, wo ich am Anfang meines Bummels gar nicht hingewollt hatte: Auf der Lueg.

Und war mir sicher: Von einer Ausnahme abgesehen, kann es auf der Welt keine schönere Gegend zum Leben geben.
Nur einmal angenommen: Der beliebte und kompetente Sachbearbeiter Peter F. ist jeden Tag angetrunken. Im Betrieb wissen alle über seinen Alkoholkonsum Bescheid. Käme es seinen Kollegen in den Sinn, ihn zu filmen, wenn er lallend mit Kunden telefoniert und schwankend vor dem Aktenschrank steht? Und würden sie den Clip weltweit veröffentlichen?
Eben.
Bei Amy Winehouse ist das etwas anderes.
Wann immer die 28jährige Britin im Geschäft erscheint, wird sie von einer unüberschaubar grossen Horde wildfremder Menschen erwartet, die jede ihrer Bewegungen und jedes ihrer Worte mit Handykameras aufzeichnen.
Nicht alle dieser Leute sind gekommen, um die grossartige Stimme, die sie von „Frank“ und „Back to black“ her kennen, einmal live zu hören.
Manche interessiert nur eines: Wie besoffen ist Amy Winehouse heute? Schwankt sie nur ein bisschen? Oder fällt sie der Länge nach hin? Nuschelt sie bloss? Oder lallt sie wie ein Junkie in der Bahnhofunterführung? Wenn ja: Gelingt es mir, sie dabei zu filmen? Und den Streifen vor allen anderen, die das Schwanken und Lallen ebenfalls aufgenommen haben, ins Internet zu stellen?
Für Letztere dürfte das Konzert, das die Künstlerin am 18. Juni in Belgrad gab geben wollte, ein ähnlich freudiges Ereignis gewesen sein wie für andere eine Hochzeit an Weihnachten: Die bis unter die Hirnrinde zugedröhnte junge Frau schaffte es kaum, sich auf den Beinen zu halten, traf keinen Ton, würgte Textfragmente ins Mikrophon und raunzte Bandmitglieder an. Der Veranstalter hatte ein Einsehen und liess die umhertorkelnde Sängerin von der Bühne holen.
Vermutlich hatte der Tourarzt seine Patientin noch nicht fertig untersucht, als die Videos des denkwürdigen Auftritts auch schon im Netz kursierten und Zigzehntausendfach angeklickt wurden. In vielen Fernseh-Nachrichen verdrängten die Bilder des Winehouse’schen Absturzes die Atomdebatte, EHEC und die Euro-Krise wie selbstverständlich von den besten Sendeplätzen.
Amy Winehouse – oder jemand, der in ihr mehr als einen bis zum Kollaps melkbaren Goldesel sieht – sagte wenig später sämtliche Konzerte ihrer Sommertournee ab. Das Management teilte mit, die Sängerin wolle sich „im Kreis ihrer Familie fernab von der Öffentlichkeit ihren Gesundheitsproblemen (…) widmen“.
„Fernab von der Öffentlichkeit“? Amy Winehouse?
Aber gewiss doch.
Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was mit Peter F. eher früher als später passiert, falls er sein Problem nicht in den Griff bekommt: Der Chef stellt ihn auf die Strasse. Dann kann F. sich in ein bodenloses Loch fallen lassen – oder abgeschottet von Druck und Stress eine Therapie machen, seine persönlichen Knoten lösen und später woanders von vorne anfangen. Vielleicht bietet ihm der Chef – das gibts – auch die Möglichkeit, die Krankheit in aller Ruhe zu kurieren, und beschäftigt ihn weiter, wenn er sieht, dass das mit dem Trockenbleiben klappt.
So oder so: Für Peter F. besteht eine Chance, seinem geliebten Beruf irgendwann wieder an einem Ort nachgehen zu können, an dem sich kaum jemand dafür interessiert, was mit ihm einmal los war.
Diese Möglichkeit hat Amy Winehouse nicht. Für sie gibt es nur Sein oder Nichtmehrsein. Entweder rappelt sie sich unter medialer Dauerbeobachtung innert nützlicher Frist aus ihrem Tief hoch, produziert eine hammermässige neue CD und absolviert anschliessend eine triumphale Tournee – oder sie verschwindet so schnell in der musikalischen Bedeutungslosigkeit, wie sie vor acht Jahren aus dem Nichts aufgetaucht ist.
Der suchtkranke Sachbearbeiter Peter F. und die suchtkranke Sängerin Amy W. unterscheiden sich weniger durch ihre Tätigkeit, als vielmehr durch ihr Umfeld: Während ihm niemand wünscht, dass er am neuen Arbeitsplatz mit alten Problemen kämpfen muss, gibt es in ihrem Fall sehr viele Menschen, die es heute schon kaum erwarten mögen, sie bald wieder lallend und schwankend vor sich zu haben. Diese Leute helfen einer Menge anderer Zeitgenossen dabei, mit dem ewigen Scheitern der Amy Winehouse unsinnig viel Geld zu verdienen.
Mein Überlebenskampf ist eure Lebensgrundlage: Das wusste Amy Winehouse an jedem einzelnen Tag, an dem sie arbeiten ging. Und daran wird sich nichts ändern, wenn sie dereinst wieder arbeiten geht.
Wer zwischendurch Mühe hat, sich für den Gang ins Büro zu motivieren, soll sich eine so grosse Hypothek einmal vorstellen. Oder zumindest versuchen, sie sich vorzustellen.
Nachtrag: Dann also: Nichtmehrsein.

„Es ist eine Plage,
es ist eine Qual.“
(„Drachenjagd„, 1. Akt, 1. Szene)
Möglicherweise hatten Schulreisen einmal einen Sinn. Vielleicht tat es den Schülern und Lehrern einst tatsächlich gut, jedes Jahr etwas anschauen zu gehen, das sie sonst nie entdeckt hätten. Das muss zu einer Zeit gewesen sein, in der die Kinder nach Zehnstunden-Schultagen und am Wochenende auf dem heimischen Hof mitchrampfen und die restliche Zeit auf harten Kirchenbänken absitzen mussten.
Doch diese tempi sind passati: Kaum hat Papi die Nabelschnur gekappt, fliegt das Baby mit dem Mami am Bauch nach Indien. Als Zweijähriges erlebt es auf dem Rücksitz der Harley von Mutters aktuellem Lebensabschnittspartner seine erste Rundreise durch die Vereinigten Staaten. In den nächsten Ferien gehts mit demselben Mami, aber mit einem anderen Mann, ab zum Bärenstreicheln in Alaska.
Am Tag der Einschulung haben Luca und Lara gesehen, was es auf der Welt zu sehen gibt. Falls sie sich für Historisches in der näheren Umgebung interessieren sollten: Virtuelle Rundgänge bietet jedes Schloss und Museum auf seiner Website an. Für Zoobesuche genügt eine SMS an den Götti oder den Erzeuger, der sowieso nie weiss, wie er die gerichtlich festgelegten drei Stunden, die er mit seinem Sprössling in allen Monaten mit „L“ verbringen darf, sinnvoll nutzen kann.
Zwischen Speed und Schleckstengel
Abgesehen von den Bäckern und Metzgern wird niemand mehr behaupten, dass Schulreisen etwas Gefreutes sind, auf das man schon Wochen im Voraus planget und über das man noch Monate später mit strahlenden Augen spricht.
Wer regelmässig Zug fährt, kennt sie: Die vor Verzweiflung verzerrten Gesichter der Lehrerinnen und Lehrer, die sich schon frühmorgens auf dem Perron eingestehen müssen, die Kontrolle über die Horde Klein- und Halbwüchsiger verloren zu haben und nur noch hoffen können, die folgenden Stunden mit einer mühsam aufrecht erhaltenen Restwürde zu überstehen; die cool vor sich hinpaffenden Kids, die jedermann signalisieren, dass sie im Fall noch Gescheiteres zu tun hätten, als auf diesem Scheiss Gurten herumzulatschen; ihre Gspändli, die nach dem Aufstehen eine Extraportion Speed eingeworfen haben, um auf diesem Ausflug soviele Nerven zersägen zu können wie möglich; die Klassenkämpfe am Kiosk: Kevin bezahlt sein Marlboropäckli mit einer Hunderternote; Maria kramt für zwei Schleckstengel ihr Münz zusammen und ist pleite, bevor der Trip begonnen hat.
„Lueg, Joshua, da isch no öppis frei“
Die einen sind finster entschlossen, der Welt zu zeigen, was wirklicher Terror ist. Die anderen bemühen sich ausserhalb ihrer geschützten Werkstatt krampfhaft, aber vergeblich, darum, zumindest den Anschein zu wahren, die Lage im Griff zu haben: Willkommen auf der Schulreise 2011, deren mobile Phase primär durch den Umstand geprägt wird, dass es die Lehrerin in den neun Monaten, in denen sie keine Ferien hatte Fortbildungsseminare besuchen musste, wieder nicht schaffte, fünf Minuten für die Reservation eines Zugabteils aufzuwenden, so dass sich all jene Bahnpassagiere, die mit diesem Reisli nicht das Geringste zu tun haben (und auch nicht zu tun haben wollen), unversehens in einer Armee Halbirrer psychisch auffälliger Mitmenschen wiederfinden, die ohne Rücksicht auf materielle und körperliche Verluste um die wenigen freien Plätze kämpfen.
Mitten im Getümmel steht die Lehrerin, der keinem ihrer Schützlinge zumuten will, die zwölfminütige Fahrt nach Bern im Stehen zu absolvieren, weshalb sie ununterbrochen schreit, „Lueg, Joshua, da isch no öppis frei“ und „Hesch gseh, Céline, wenn dä Ma si Laptop uft Ablaag ufe leit, chasch du grad da härehöckle.“
Am Abend dann, wenn die eine Hälfte der Klasse in der örtlichen Ausnüchterungszelle randaliert und die andere Hälfte beschwörend auf Schadensexperten von Versicherungen einredet, am Abend also setzt sich die Lehrerin mit ihrer Freundin, die sie nichts Böses ahnend auf diesem Trip durch die Hölle und zurück begleitet hat, in eine stille Ecke im „Rössli“.
Erschöpft, aber unverletzt blicken die beiden auf den Tag zurück. Nach den ersten paar Litern Rotwein kommen sie zum Schluss, dass die Reise, wenn man lange genug darüber nachdenke, auch seine positiven Seiten hatte: Dass das überfüllte Gurtenbähnli den Berg hochgekommen sei, habe sie „total spannend“ gefunden, sagt die Begleiterin. „Das spontane Zvieri im Restaurant war schampar lässig“, strahlt die Lehrerin.
„Und hast du gesehen? Ich habe auch für Joshua noch ein Plätzli gefunden.“