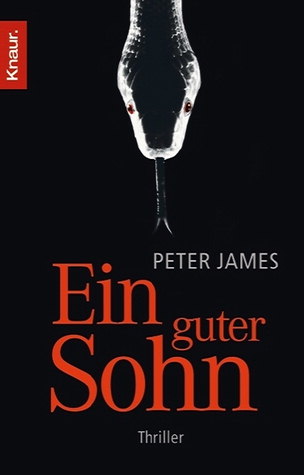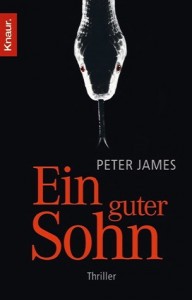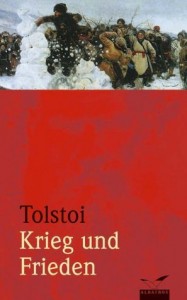Der Titel war Programm: Zu ihrem 70. Geburtstag schenkte ich Mamma mia den Krimi “Ein guter Sohn”.
Den Inhalt des Buches kannte ich nicht. Aber ich wusste, dass meine Mutter Mord- und Totschlagliteratur genauso leidenschaftlich verschlingt wie Armin Meives die Extremitäten seiner Internet-Bekanntschaften.
Wenig später erreichten mich sms, mit denen mich die Beschenkte sinngemäss dahingegend orientierte, das sei jetzt schon ziemlich Wää und kaum zum Aushalten und, kurz zusammengefasst, etwas vom Schlimmsten worüber ihre schon an allerhand gewöhnten Augen je geschweift seien. Natürlich las meine Mutter das Buch trotzdem fertig. Oder genau deshalb.
Nun habe auch ich mich durch den Roman gekämpft. Wobei: “gekämpft” trifft es nicht ganz. Die Geschichte um einen moralisch nicht übertrieben gefestigten jungen Mann, der sich an all den Menschen, die seiner Mutter Zeit ihres Lebens nicht die gewünschte Aufmerksamkeit entgegenbrachten und von ihm deshalb auf höchst unterschiedliche Weisen aus dem Weg geräumt werden, hat mir, um es zurückhaltend zu formulieren, durchaus zugesagt.
Ich mag hier nicht in die Details gehen; vielleicht lesen ja auch Kinder mit. Deshalb nur soviel: Einer jungen Frau bricht der Junior mit einer Zange die Finger- und Fussnägel ab; dann lässt er sein Opfer im finsteren Keller verdursten. Einem Nachwuchsreporter amputiert er, auf jegliche Narkosemittel verzichtend, mit einer Motorsäge die Handgelenke und verlötet die Stümpfe mit einem Bunsenbrenner, damit der ignorante Journi nicht zu schnell ausblutet und stirbt. Einer ehemaligen Rivalin seiner Mutter stülpt er einen Plasticsack voller hungriger Maden über den Kopf.
Das alles ist sehr flott und anschaulich beschrieben, wirkt in sich logisch und liest sich in einem Schnuuz durch. Aber, eben: Ich habe das Buch ja nicht zu meinem Vergnügen gekauft.
Nach diesem Flop bin ich schon jetzt am Überlegen, was ich meiner Mutter im November auf den nächsten Geburi schenken könnte. Mein Mailfach ist ab sofort für Tipps geöffnet.
Ich rate dringend, der Angelegenheit die nötige Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen.