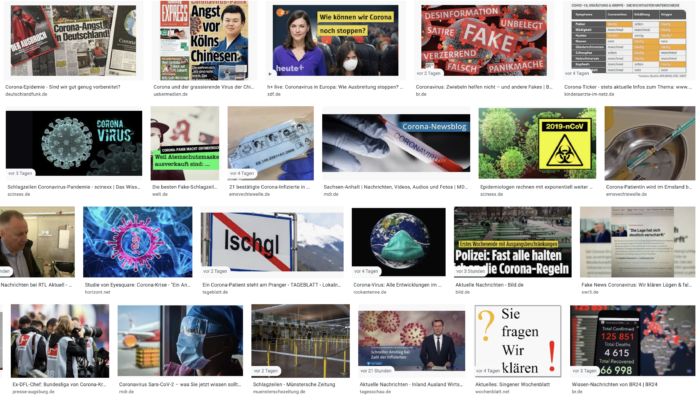
Als ich vorhin die letzten Corona-Nachrichten mit aktuellsten Fallzahlen. Livetickern, hastig in Laptops gehackten Reportagen aus Krisenregionen, Podcasts von Gesundheitsfachleuten, vor wenigen Minuten lancierten Hilfsaktionen und einem Blutspendeaufruf sichtete, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Was wäre gewesen, wenn dieses Virus vor dem Internetzeitalter gewütet hätte?
Mails, Skype oder Whatsapp gab es Mitte der 80er Jahre genausowenig wie Facebook, Twitter oder Youtube. Lokal- und Tageszeitungen informierten Herrn und Frau Schweizer über das Geschenen vor ihren Wänden, im Wankdorf und in Washington. Die elektronische Medienlandschaft bestand aus dem Radio und Fernsehen SRF, der ARD und dem ZDF.
Nachrichten erreichten ihre Publikum nicht selten mit grosser Verspätung. Am 26. April 1986 zum Beispiel explodierte in Tschernobyl ein Atomreaktor. Erst drei Tage danach erschienen in westlichen Medien die ersten Berichte über das Unglück.
Wenn man das inflationsbereinigt und aufgrund meines mathematischen Basiswissens hochrechnet, kommt man automatisch zum Schluss, dass es Punkt 68 Jahre, 14 Monate, 8 Wochen und 17 Tage gedauert hätte, bis das Corona-Virus medial bei uns angekommen wäre.
Unter uns wären die unsichtbaren Eindringlinge trotzdem schon, was bedeutet: Ahnungslos wie Forrest Gump würden wir total vervirt weiter an Grossveranstaltungen und in Restaurants gehen und Senioren oder Kranke in Heimen und Spitälern besuchen. Tag für Tag steckten Zehntausende Zehntausende an. Ende Woche wäre der Leerwohnungsbestand in der Schweiz auf einem ewiggültigen Allzeithoch angekommen. Gräber und Urnenplätze könnten sich nur noch die Reichsten der Reichen leisten. Alle anderen müssten auf der faulen Haut herumliegen und warten, bis sich die Lage beruhigt. Letzteres ist vielen von uns inzwischen ja bestens vertraut.
Die überlebenden Angehörigen der nachfolgenden Generationen würden schnell merken, dass ihnen die Alten nicht nur eine schwer reparaturbedürftige Erde vermachten, sondern auch jede Menge Zeugs, mit dem sie etwas anfangen können, ohne es vorher in Ordnung demonstrieren zu müssen.
Wenn ich einige Erbinnen und Erben jetzt gerade so schön in der Leitung habe, nutze ich die Gelegenheit, ihr Allgemeinwissen mit einem Müsterchen aus der kommunikativen Steinzeit zu tunen, gerne; genauso, wie unsere Grossväter uns früher vom Zweiten Weltkrieg berichteten, nur mit ohne verdunkelten Fenstern, fernem Bombendonner und all den Streichen, mit denen Vögeli Kurt sel. den Kadi solange in den Wahnsinn trieb, bis er (der Kadi) ihm (Vögeli) sagte, er solle ihm doch in die Schuhe blasen, worauf Vögeli eines Nachts, als der Kadi schlief, sich süüferli aus seinem Feldbett erhob, quer durch die Soldatenunterkunft zum Nest des Kadis täppelte, ein Paar von dessen Schuhen darunter hervorzog und! tatsächlich!! hineinblies!!!.
Das Mass aller Dinge war für uns Journalistinnen und Journalisten ein „Telekoppler“. Dazu muss man wissen: Medienschaffende sassen zu jener Zeit nur im Büro, wenn ihr Chef sie dazu zwang, was aber kein Chef je tat; ganz im Gegenteil. Meist waren wir Schreiberlinge draussen, um mit Leuten zu reden und Dinge anzuschauen.
Die besten Geschichten schnappten wir häufig in Gartenbeizen auf und oft genau dann, wenn wir kaum mehr in der Lage waren, unfallfrei zwei Sätze hintereinander zu notieren. Das spielte aber überhaupt keine Rolle, jedenfalls nicht für uns: Das wesentlich Scheinende behielten wir plusminus im Kopf, den Rest machten wir später passend.
Gartenbeizen wiederum – dies zK. der Neugeborenen – waren lauschige Plätze mit Kies drauf und Kastanien drumherum. An Vierertischchen und an langen Tafeln sassen nicht selten mehr als fünf Personen auf einmal, um Seit‘ an Seit‘ miteinander zu plaudern, zu essen und sich dem Trunke hinzugeben).
Aber item. Mit diesen ziegelsteingrossen und -schweren Telekopplern liessen sich Texte aus öffentlichen

Telefonkabinen
direkt in die Redaktion übermitteln; zumindest theoretisch. In der Praxis endeten diese Versuche meist damit, dass der Berichterstatter vor Ort um kurz vor Mitternacht totalentnervt in die Zentrale anrief, um den Beitrag der Sekretärin, die gerade nach Hause eilen wollte, um ihren Liebsten mit einem raffinierten Dreigänger vor dem Hungertod zu bewahren, es aber nicht übers Herz brachte, den Anruf zu ignorieren, in die IBM-Kugelkopfmaschine zu diktieren.
Wer einmal so einen Telekoppler oder eine original echte Telefonkabine oder auch nur einen Telefonapparat aus der Nähe betrachten will, kann das im Museum für Kommunikation in Bern jederzeit nicht tun.