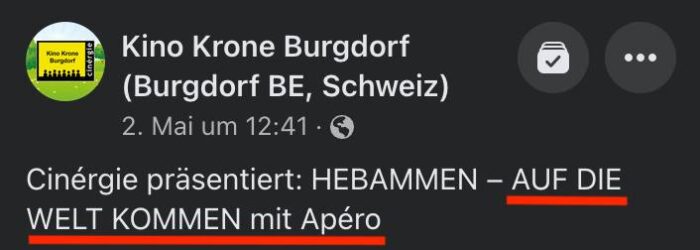Medienmitteilung
Der Fall beschäftigte die halbe Deutschschweiz: Im letzten September beschlagnahmte der Bund bei Hannes H. in Burgdorf einen Rosmarinstock. Die Pflanze, befürchteten die Behörden, könnte unter einer ansteckenden Krankheit leiden.
Untersuchungen im Labor bestätigten diesen Verdacht zwar nicht, doch H. half dies wenig; das Kraut wurde nach den Tests vernichtet.
Nach neun Monaten des Haderns und Zweifelns kann H. nun wieder strahlen: Heute Nachmittag brachte ihm Sibylle Gosteli, die beste Floristin der Welt, einen neuen Rosmarinstrauch auf den Balkon. Damit er – also: der Strauch – sich nicht so einsam fühlt, stellte sie ihm etliche Gspändli zur Seite:











„Auf meine grünen Mitbewohnerinnen werde ich aufpassen wir ein Häftlimacher“, sagt H.. Sein Bett und sein Büro verlege er ab sofort und bis sicher Ende Herbst nach draussen. Zu darüberhinausgehenden Vorsichtsmassnahmen möge er sich „aus Datenschutzgründen“ nicht äussern, fügte er an.