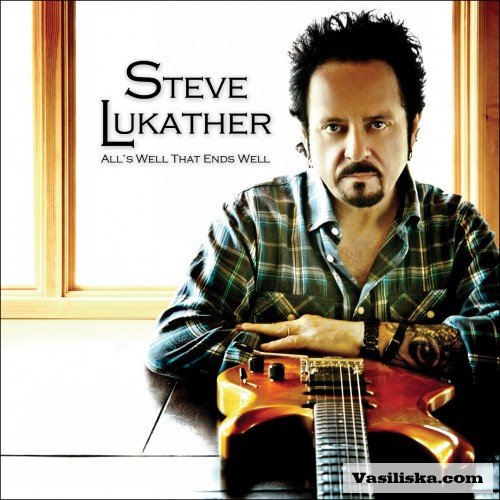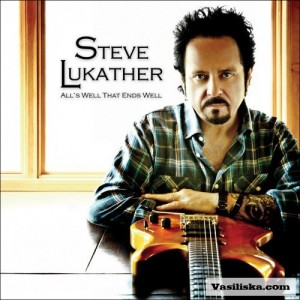Da will man am frühen Morgen, nach einer mehrtägigen Computerabstinenz, mal wieder in dieses Internet gehen – und kaum hat mans geöffnet, purzeln einem auch schon die ersten Geburtstagswünsche entgegen. Manche hatte man unbedingt erwartet, andere kommen eher überraschend – aber aufstellende Wirkung haben sie alle. Es ist so schön, sich zumindest an einem von 365 Tagen nicht so alleine fühlen zu müssen auf dieser kalten, windigen und nassen Welt, in der ein paar Chilenen aus dem Untergrund einen neuen Sonnenbrillentrend setzen können, während in Asien weiterhin minderjährige Haifische billige T-Shirts für modebewusste Inder zusammennähen.
An meinem 45. Geburtstag gestatte ich mir, liebe Festgemeinde, einen kurzen Blick zurück…und schaue jetzt vorne. Heute ist, um es mit den Worten des grossen Tierforschers Louis Armstrong zu sagen, ein kleiner Tag für mich, aber ein grosser Tag für meinen Brüetsch: Ab 13.30 Uhr läuft er den Hallwilersee-Halbmarathon.
Vor einem Jahr hätte, ausser mir, noch niemand viel darauf verwettet, dass er das am 16. Oktober 2010 tun würde. Damals wog er 25 Kilo mehr, rauchte, kannte das Wort „Bewegung“ nur vom Hörensagen oder – wer weiss? – aus etwas handlungsarmen Filmen und frönte, wie man so sagt, einem alles in allem recht flatterhaften Lebenswandel.
Aber dann: klemmte er sich in seinen ausgeprägten Hintern, begann, nordic zu walken und gesund zu essen, entsagte er dem Nikotin, begab er sich regelmässig ins Fitnesstudio, absolvierte er aus einer Laune heraus den „Engadiner“ und verlobte er sich schliesslich mit seinem Schatz, was dem Wohlbefinden von beiden Beteiligten ebenfalls höchst förderlich war.
Und nun steht er in wenigen Stunden in der Häsigasse am Start zum – nach dem Heiratsantrag – wohl grössten Abenteuer seines Lebens.
Liebe Festgemeinde: Wenn das keinen Applaus wert ist – was dann?
Danke.
Womöglich Sehr wahrscheinlich Ganz bestimmt klingts ein wenig pathetisch, wenn ich sage, dass das mein tollstes Geburigeschenk sein wird: den Brüetsch heute Nachmittag im Ziel des Hallwilerseelaufes einlaufen zu sehen. Natürlich wusste ich schon vor einem Jahr, dass er das schaffen wird. Aber ich konnte damals unmöglich ahnen, wie stolz ich in nicht allzu ferner Zukunft auf meinen kleinen Bruder sein würde: schampar.
Nachtrag: Urs hat den See in zwei Stunden, acht Minuten und dreizehn Sekunden umrundet. Und war im Ziel ein gefragter Mann:
Der Fanclub scheute weder Kosten für Farben noch Mühe zum Malen: