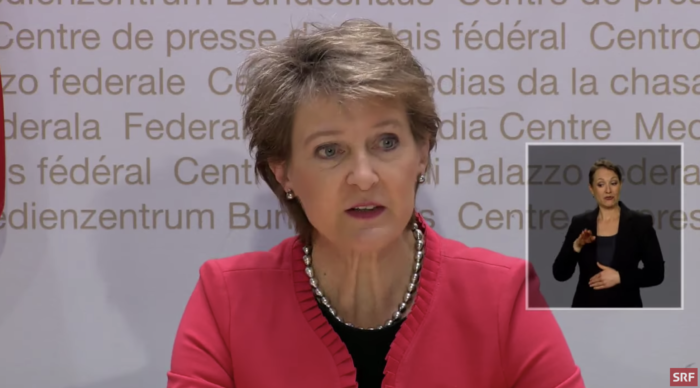Spätnachts höre ich manchmal Stimmen. Um Mitternacht herum treffen sich vor einer stillgelegten Altstadtbeiz, in der dem Betäubungsmittelgesetz bis zum 16. März auf eine relativ unverkrampfte Art und Weise nachgelebt wurde, regelmässig ein paar Männer.
Sie wussten schon lange vor dem Lockdown, was es heisst, Tag für Tag die Zeit totschlagen zu müssen, und gehen auf der Gasse zu vorgerückter Stunde gerne ein letztes Mal durch, was ihnen heute wieder Übles widerfahren war (Scheiss Sozialdienst, Scheiss Bullen, Scheiss Ex, Scheiss alles), bevor sie sich in ihren vom Sozialdienst finanzierten Wohnungen schlafenlegen und, wer weiss?, albträumen, wie die Ex bei einem Polizisten an allem herumchäschperlet.
Neulich hatte einer der Herren Lämpe mit einem Kollegen, dem er offenbar seit geraumer Zeit einen Fünfziger schwach ist. Der Schuldner verwies weinerlich ein ums andere Mal darauf, dass die IV ihm sein Geld noch nicht überwiesen habe, der Gläubiger entgegnete ungerührt, das sei nicht sein Problem. Hier Stoff – da Stutz: so laufe das und basta. Der Disput wurde lauter und lauter, doch als ich dachte, gleich häscherets, verzogen sich die beiden nach irgendwohin.
Sie liessen mich unter meinem halbgeöffneten Dachfensterchen mit einer Frage zurück, die ich mir noch nie gestellt hatte: Wo bekommen Leute mit einem Hang zum Hanf jetzt, wo die einschlägigen Treffpunkte geschlossen sind und ein Dealer auf dem kaum noch frequentierten Bahnhofareal auffallen würde wie ein Schprutz Ketchup auf einem Hochzeitskleid, eigentlich ihre Tabak-, Tee- und Guetzliergänzungsmittel her?
Pfannen, Ponys, Perkussionsinstrumente, Pflanzen, Parkbänke, Penisringe, Pflastersteine, Pflüge, Palmkernöl, Paketadresskleber, Pistolen, Petrischalen, Pedalos, Perserkatzen, polnische Pässe, Perücken, Pizza: Was immer der Mensch zum Leben braucht, lässt sich auch mitten in Corona gäbig online beschaffen, es braucht nicht einmal unbedingt mit einem P zu beginnen.

Wer ein Pfund Marju Marhi Marjuh Gras benötigt, kann jedoch ewig durch die Hochregallager von Amazon oder die Inserateplantagen in der „Tierwelt“ schlurfen, ohne je fündig zu werden.
Vermutlich wird der Vertriebskreislauf mit raffiniert codierten Inseraten in der Lokalzeitung („Frisch ab Biene: Grüner und schwarzer Honig zum Selberdrehen!)“ oder bei als Nachbarschaftshilfe getarnten Hausbesuchen notdürftig in Schwung gehalten, bis der Bundesrat das Versammlungsverbot aufhebt und der Handel vor der Berner Reitschule, auf der Grossen Schanze und andernorts wieder blüht wie hoffentlich bald auch das hochpotente Kraut in der Tomatenplantage des nichtsahnenden Grosis.
Serienkiller nutzen seit Kurzem modernste Kommunikationsmittel, um ihre Leichen plasticsackkompatibel zerlegen zu können, ohne wegen unerlaubten Aufenthalts im Freien eine Busse zu riskieren. Nach der Devise „Stay home – safe lifes“ organisieren sie sich das Werkzeug vom Küchentisch aus via Facebook :
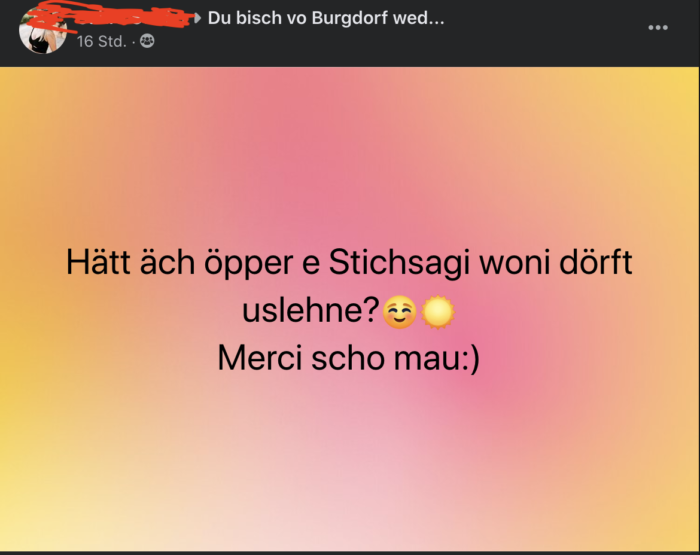
Schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem Behältnis für die Exkre Exeku Ejak Körperteile. Auch bei nicht fanatisch ökoorientierten Schwerkriminellen geniesst Plastic inzwischen einen zweifelhaften Ruf, aber aus den cheibe Jutetaschen rinnt einfach zuviel Körperflüssigkeit, und selbst wenn in den Sternen stehen würde, wann bei Nachbars die nächste Tupperwareparty steigt: lesen könnte es ja doch niemand.
Bei uns Bünzlis hingegen wird Vieles auch dann so bleiben, wie es schon immer war, wenn die fünfte Virenwelle über das Land geschwappt ist. Dass Handwerker die frischgestaubsaugte Wohnung mit rundumverdreckten Schuhen betreten etwa, oder dass entfernte Bekannte, die einen um kurz nach 23 Uhr aus dem Schlaf reissen, weil sie sich einfach mal total sponti danach erkundigen wollen, „wies dir so geht“, zum Einstieg fragen, ob sie grad stören, oder dass sich die Kaufenden und Verkaufenden in der Bäckerei wechselseitig je achtmal für die Gipfeli und das Geld – hier Stoff, da Stutz – bedanken, bevor sie zu überlegen beginnen, ob sie wohl langsam erwägen könnten, darüber nachzudenken, sich noch vor Sonnenuntergang voneinander zu verabschieden.
Damit gehts aus der Zukunft huschhusch zurück in die Gegenwart. Heute Nachmittag steht unser vierter Waggu am Emmeufer auf dem Programm; am Abend habe ich Besuch. Dafür muss ich nochly einkaufen gehen.
Das dürfte kein Problem sein: die Gäste kommen zum Essen, nicht zum Kiffen.