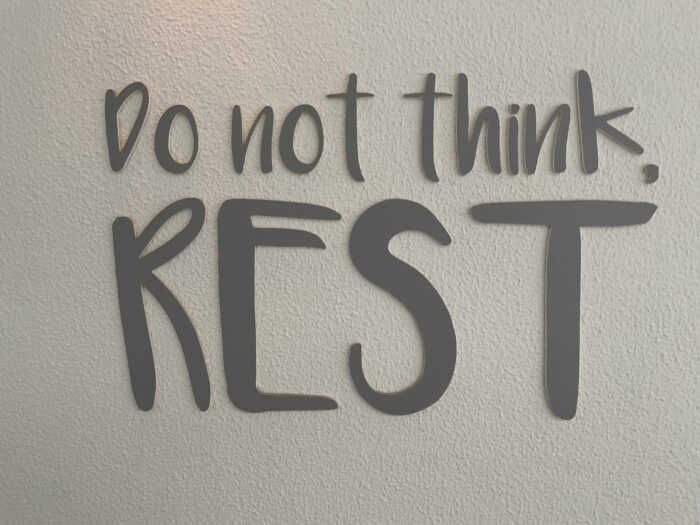Freitag, 12. März 2021, 15.10 Uhr
Abgesehen davon, dass das Management meines Hotels ein schwules Paar auf die Strasse stellte (genaugenommen war es so, dass der eine der beiden vor seinem zugekoksten Partner in eine andere Unterkunft flüchtete, worauf dem anderen dringend nahegelegt wurde, sich ebenfalls eine neue Bleibe zu suchen), ist in meinem Temporär-Zuhause in den letzten Tagen wenig Erwähnenswertes passiert und schon gar nichts, was auf dem Festland von Belang sein könnte.
Aber jetzt kommt möglicherweise wieder chly Leben in die Bude. Um kurz vor 8 Uhr checkten heute sechs Männer ein, samt Velos und sehr, sehr viel Gepäck.
Bei der Gruppe handelt es sich, wie mir Miguel von der Rezeption berichtete, um Radrennfahrer aus Osteuropa, die sich auf Gran Canaria jedes Jahr um diese Zeit auf die neue Saison vorbereiten.
Wohnen mit Veloprofis: das ist für mich neu. Bisher lebte ich in Hotels sozusagen fast meistens mit Superstars aus der Wintersportszene zusammen.
Letztes Jahr in Davos zum Beispiel quartierte sich im Zimmer nebenan eine leibhaftige Langlauf-Olympiasiegerin ein. Und auch wenn es mir nie in den Sinn kommen würde, Jessica Diggins und ihre Kolleginnen und Kollegen von der US Cross Country-Nationalmannschaft mit einem halben Dutzend spatengesichtiger Menschmaschinen aus einem Achsenstaat des Bösen zu vergleichen: wo ich bin, sind mit erstaunlicher Regelmässigkeit auch andere Topathletinnen und -athleten.
Die Tour de France 1997 – mit Jan Ullrich, Richard Virenque und Marco Pantani als Erstem, Zweitem und Drittem der Inbegriff einer sauberen Sache – legte genau dann einen Etappenhalt in Freiburg ein, als ich daselbst meine Welschlandjahre absolvierte.
Der FC Luzern hielt sein Trainingslager in den 80er-Jahren jeweils in Beromünster ab, während ich zwei Dörfer daneben wohnte und arbeitete. Dank der FCL-Helden konnte ich Sommer für Sommer das nach ihm benannte Loch notdürftig stopfen. Hätte Adrian Knup nicht eines unschönen Tages den Blitz meiner Minolta in plusminus tausend Stücke geschossen, hätte es mit meinen Stippvisiten noch ewig so weitergehen können.
Aber: er schoss, und deshalb laufen der Zentralschweizer Traditionsverein und ich rund 30 Jahren nicht mehr ganz so synchron. Eine winzige Teilschuld an diesem Zerwürfnis nehme ich mit etwas zeitlichem Abstand auf mich. Angefangen hat indes unzweifelhaft Knup, indem er kurz zuvor den Vertrag mit dem FCL unterzeichnete.
Ich hingegen meinte es nur gut. Um der Leserschaft einmal ein anderes Bild als die ewig gleichen Aufnahmen sich stretchender Spieler, ihres in Gedanken versunkenen Trainers Friedel Rausch, mit Klemmbrettern umherstolzierender Mannschaftsbetreuer oder von Kopf bis Fuss blauweiss gewandeter Fans zu bieten, wollte ich Knup an jenem Morgen beim Üben von Freistössen fotografieren, und zwar aus einem möglichst spektakulären Winkel und im Gegenlicht. Also bezog ich neben dem linken Pfosten Posten.
Dass die verzerrte Objekt-Perspektive für Irritationen in meinem Distanzgefühl sorgen würde, bedachte ich nicht, als ich den Fotoapparat in Anschlag brachte. Ich sah zwar, dass der Ball in ziemlich genau meiner Richtung unterwegs war, realisierte aber zu langsam, wie schnell er sich näherte. Durch die Linse betrachtet, flog er eher gemächlich durch die Luft. Tatsächlich hätte er eine bis weit über die Grenzen der Legalität hinaus frisierte Interkontinenzrakete überholt.
In dem Sekundenbruchteil, in dem das „gut“ von „Tami, das kommt nicht gut“ durch meine Gehirnwindungen raste, schlug die Lederkugel in das fragile Hartplastiktürmchen auf der Kamera ein. Wie Friedel Rausch mich daraufhin vor der kompletten Mannschaft zusammenstauchte, werde ich mein Lebtag nicht vergessen.
Beim Versuch, eine Versicherung zu finden, die für den Schaden aufkommen könnte, lernte ich fernmündlich zwar die auf der FCL-Geschäftsstelle mitwirkende Tochter des damals noch gottähnlichen Lozäärn-Präsidenten Romano Simioni kennen. Doch so treuherzig ich auch in den Telefonhörer guckte: sie erteilte mir ebenso einen abschlägigen Bescheid wie alle anderen Leute, auf deren Kulanz ich zu hoffen gewagt hatte.
Knup seinerseits wurde vom Schicksal spät, dafür aber fast überhart bestraft: es wies ihm einen Sitz im Verwaltungsrat des FC Basel zu).
Und wereliwer kam zur Türe herein, als ich in der Endphase des letzten Millenniums eine Art Date in der Autobahnraststätte in Egerkingen hatte? Genau: Werner Günthör.
In Davos weilten gestern Edith und Jürg, zwei Minigolfgspändli. Als sie vor dem Hotel standen, in dem ich im Dezember gastierte, entsannen sie sich der Romanze mit Jessica Diggins, die ansatzweise einzufädeln mir zumindest theoretisch vielleicht vergönnt gewesen wäre, wenn wir nur ein paar Monate mehr Kennenlernzeit gehabt hätten als die zehn Sekunden auf dem Balkon und sie eine gewisse Bereitschaft dafür hätte aufbringen mögen, in mir den Vater ihrer dann halt noch zu zeugenden Kinder zu sehen statt just another guy, dem, wenn er ihrer in einem jener zig Logis, in welchen sie während der Weltcupsaison abzusteigen pflegt, Gewahr wird, nichts Originelleres einfällt, als sie um ein gemeinsames Selfie zu bitten, und schickten mir das oben abgebildete Grüessli.
Ist das nicht allerliebst?